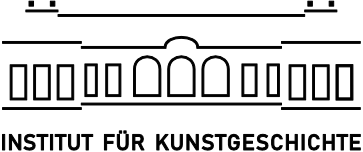Die Bildgeschichte der Botanik
Die Bildgeschichte der Botanik
Projektleitung: Prof. Dr. Hans Dickel
Wiss. Mitarbeit: Almut Uhl
Kooperationspartner: Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek, Lehrstuhl für Buchwissenschaft und Herbarium Erlangense der Universität Erlangen-Nürnberg
Finanzierung: Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e.V.
Das Forschungsprojekt fragt aus wissenschaftsgeschichtlicher und bildwissenschaftlicher Perspektive nach der Funktion botanischer Illustrationen bei der Identifizierung und Analyse von Pflanzen seit der frühen Neuzeit. Der seit der Antike schriftlich überlieferte Wissenskanon hatte mit der Entdeckung neuer Pflanzen in Nordeuropa und Übersee seine Autorität verloren und wich einer neuen Empirie der Anschauung.
Pflanzendarstellungen in der Nachfolge Albrecht Dürers und Albrecht Altdorfers ergänzen in den Kräuterbüchern des 16. Jahrhunderts und den Florilegien und Prachtbänden des 17. Jahrhunderts den gedruckten Text. Die wissenschaftlichen Pflanzenzeichnungen Conrad Gessners („Historia plantarum“) bilden schließlich eine Voraussetzung für jene Optimierung und Verfeinerung der botanischen Illustration, die der Nürnberger Gelehrte Dr. Christoph Jacob Trew (1695-1769) mit seiner kolorierten Kupferstichserie der „Plantae selectae“ anstrebte. Grundlage des Forschungsprojektes sind die umfassenden Bestände aus Trews medizinhistorischer Sammlung, die heute in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg aufbewahrt werden.